Zusammenfassende Bewertung des Österreichischen Programms für ländliche Entwicklung zu den Querschnittsthemen Umwelt und Klima
Die Bewertung berichtet über die Effektivität des Erreichten in Bezug auf Priorität 5 (Ressourceneffizienz, kohlenstoffarme und klimaresistente Wirtschaft) und Priorität 4 (Ökosysteme in Verbindung mit Land- und Forstwirtschaft) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (EPLR).
- Austria
- 2014-2022
- Cross-cutting impacts
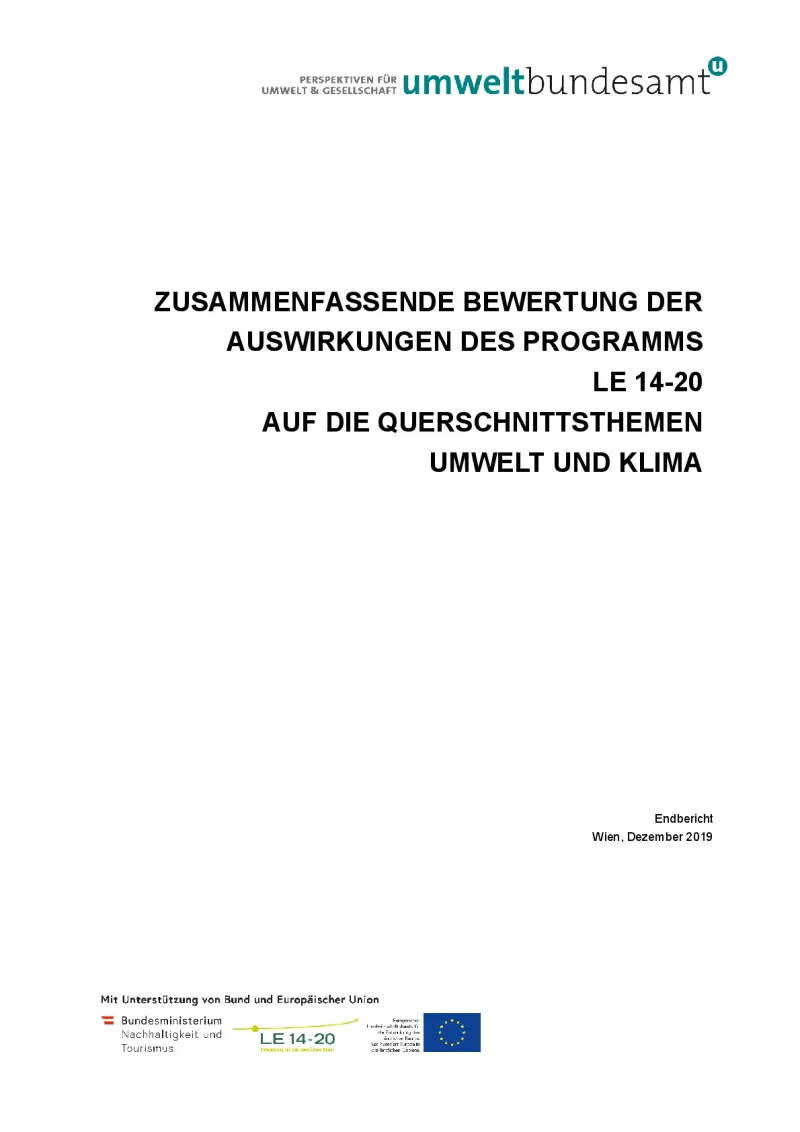

Die Bewertung zieht Bilanz über die Auswirkungen des österreichischen EPLR 2014–2020 auf Umwelt, Klima, Biodiversität und Wasserqualität nach drei Jahren der Umsetzung. Sie wurde von 19 Experten aus verschiedenen österreichischen Institutionen (Umweltbundesamt, Universität für Bodenkultur, BAB und HBLFA Raumberg-Gumpenstein) im Auftrag des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus durchgeführt.
Die Bewertung konzentriert sich auf die Wirksamkeit der im Rahmen der beiden EPLR-Schwerpunkte umgesetzten Maßnahmen: Priorität 5 (Ressourceneffizienz, kohlenstoffarme und klimaresistente Wirtschaft) und Priorität 4 (Ökosysteme in der Land- und Forstwirtschaft). Sie befasst sich mit den gemeinsamen Bewertungsfragen (CEQ) (Nummern 24, 26 und 28), über die unten berichtet wird. Andere nationale Spezialthemen, wie die Auswirkungen des Entwicklungsprogramms auf Lärm, Luftverschmutzung und Anpassung an den Klimawandel, werden in dieser Bewertung ebenfalls behandelt.
Das Ausmaß, in dem das EPLR 2014–2020 zur Reduktion der THG und zum Klimaschutz beigetragen hat, wurde anhand der Modellrechnungen des WIFO (2019) und des Umweltbundesamtes abgeschätzt.
Für die Bewertung der CMEF-Ergebnisindikatoren R.14 (Energieeffizienz) und R.15 (Erneuerbare Energien) standen nur Monitoringdaten für einen kurzen Umsetzungszeitraum zur Verfügung. Daher konnten hier keine Wirkungen bewertet werden.
Zur Bewertung der Auswirkungen auf die Biodiversität können auch längere Zeitreihen herangezogen werden. Für die Bewertung der Auswirkungen des EPLR auf den Humusgehalt der Ackerflächen sowie die Wassermenge und -qualität sind jedoch nur begrenzt Daten für ganz Österreich verfügbar.
Insgesamt gibt es keine konsolidierten, übergreifenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Jede Bewertungsfrage wurde als eigenständiges Thema beantwortet.
Aufgrund mangelnder Dokumentation war es schwierig, genau zu beurteilen, inwieweit die EPLR-Maßnahmen, insbesondere der Wissenstransfer und die Informationsmaßnahmen, zur Anpassung an den Klimawandel beigetragen haben.
Die Bewertung kommt zu den folgenden Schlussfolgerungen:
Zu CEQ 24 – „Inwieweit hat das EPLR zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zur Erreichung der Kernziele der EU 2020 beigetragen (...)?“:
- Aufgrund der Beibehaltung der flächendeckenden Landwirtschaft kam es zu einem leichten Anstieg der THG-Emissionen aus dem Agrarsektor (+2,6 %).
- Ein Anstieg der Emissionen oder eine Verringerung der Senke auf diesen landwirtschaftlichen Flächen wäre ohne einzelne Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AECM) zu erwarten, da verschiedene AECM-Maßnahmen eine kohlenstofferhaltende oder kohlenstoffaufbauende Wirkung haben.
- Andererseits ergaben die Berechnungen eine Verringerung (-2,6 %) der Ammoniakemissionen trotz des höheren Viehbestands und der größeren Mineraldüngermengen.
- Das Ziel, die Effizienz der Energienutzung in der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung zu steigern, wurde aufgrund der geringen Inanspruchnahme der geplanten Mittel in den ersten drei Jahren des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum noch nicht erreicht.
Zu EQ 26 – „Inwieweit hat das EPLR zur Verbesserung der Umwelt und zur Erreichung des Ziels der EU-Biodiversitätsstrategie beigetragen (...)?“:
- Die Populationstrends der Feldvögel haben sich (in den letzten 3–4 Jahren (Stand 2018)) auf niedrigem Niveau stabilisiert. Insgesamt ist ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Erhalt von artenreichem, extensiv genutztem Grünland wichtig für den Erfolg des nächsten Biodiversitätsprogramms.
- Im Laufe der Jahre ist ein leichter Rückgang von Ackerland des Typs 1 mit hohem Naturschutzwert (HNV) zu verzeichnen, was den rückläufigen Trend bei extensiven Grünlandflächen widerspiegelt.
- Nach der Folgenabschätzung ist das EPLR der wichtigste Einzelfaktor, der die untersuchten Biodiversitätsindikatoren gezielt beeinflusst. Das EPLR als Ganzes steuert jedoch derzeit nicht die entscheidenden Einflussfaktoren auf die Biodiversität im Acker-, Grünland- und Almbereich. Bei entsprechender Ausgestaltung könnte die Wirkung des Programms deutlich größer sein als derzeit.
Zu EQ 28 – „Inwieweit hat das EPLR zum Ziel der GAP beigetragen, eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutzmaßnahmen zu gewährleisten“:
- Die Bewertung zeigt, dass die Erhaltung extensiver landwirtschaftlicher Flächen eine wichtige Rolle für die Biodiversität spielt und dass gezielte Bewirtschaftungsauflagen entscheidend sind.
- Der aktuelle Humusgehalt auf Ackerflächen in ausgewählten Gebieten zeigt, dass er auf einem günstigen Niveau stabil geblieben ist bzw. bei humuszehrenden Kulturen sogar leicht zugenommen hat, während er bei humusfördernden Futterpflanzen zurückgegangen ist.
- Hinsichtlich der Wasserqualität zeigen die Analysen, dass die Anforderungen an einen guten chemischen Zustand in Bezug auf Nitrat in Gebieten mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und geringer Grundwasserneubildung nicht ausreichend erfüllt sind.
- Der Beitrag des EPLR zum Klimaschutz muss differenziert betrachtet werden. Einerseits kommt es zu einer Ausweitung der Produktion und damit zu einer Zunahme von Treibhausgasen, andererseits fördern Maßnahmen aus dem Programm den Kohlenstoffaufbau und -erhalt im Boden und die Ammoniakemissionen werden reduziert.
Author(s)
Federal Environment Agency Austria