Auswirkungen der Förderung der Agrarumwelt für die ökologische Landwirtschaft
Ziel ist es, die Durchführbarkeit der Überwachung der Auswirkungen der Förderung der Agrarumwelt für die Ökologische Landwirtschaft in England zu bewerten.
- Other
- 2014-2022
- Environmental impacts
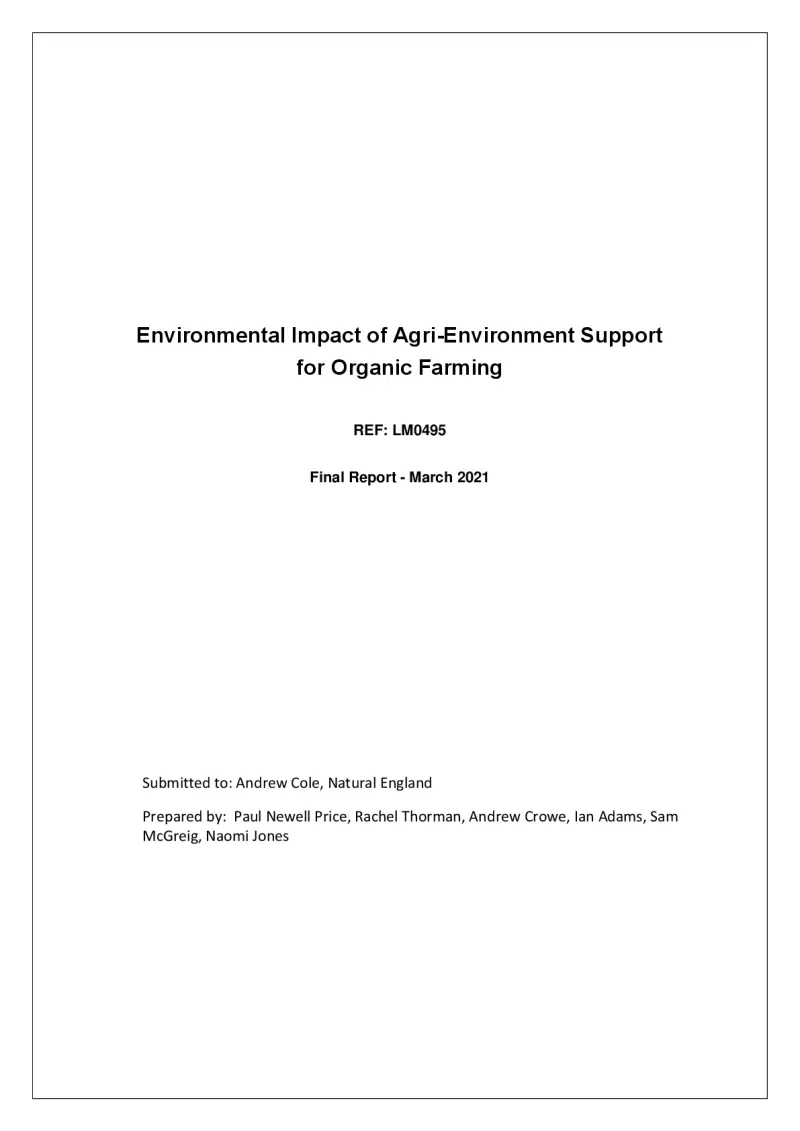

Das Hauptziel bestand darin, die Durchführbarkeit der Überwachung der Auswirkungen der Agrarumwelt-Förderung für die Ökologische Landwirtschaft, insbesondere auf die Bodenqualität, die Wasserqualität und die Landschaft, zu bewerten.
Die Bewertung der Förderung der Ökologischen Landwirtschaft im Rahmen der Agrarumweltregelung (AES) erfolgte durch die Entwicklung von fünf Bewertungsfragen und hauptsächlich durch eine Feldstudie auf 15 gepaarten Feldern (insgesamt 30), wobei jeweils ein Feld in der Option OT3 (Ökologisches Flächenmanagement – Rotationsflächen) und ein Feld mit ähnlichem Bodentyp nicht in der Option OT3 (das kontrafaktische Feld) lag.
Auf jedem Feld wurden Bodenproben entnommen, um die physikalischen und biologischen Eigenschaften zu bewerten, einschließlich der DNA-Sequenzierungstechnologie zur Bewertung der Bodenbiota. Das Risiko für die Qualität des örtlichen Oberflächenwassers wurde auch durch die Bewertung des Bodenerosionsrisikos, die Vernetzung der Landschaft und die Beobachtung von Erosionsmerkmalen berücksichtigt.
Die Landschaftsmerkmale wurden anhand einer schriftlichen Arbeit unter Verwendung der Land Cover Map 2015 bewertet, um Bodenbedeckungsklassen zu ermitteln und verschiedene Metriken zur Landschaftsstruktur zu berechnen.
Es wurden zwei wesentliche Einschränkungen festgestellt. Die erste bezieht sich auf den Zeitpunkt der Probenahme:
- Die Bodenqualität und die Risiken für die Wasserqualität werden am besten untersucht, wenn die Böden ihre Feldkapazität erreicht haben (in der Regel zwischen Mitte Oktober und April).
- Der ideale Zeitpunkt für die Beprobung von Bodenbiota kann unterschiedlich sein, hängt aber von den untersuchten Artengruppen ab.
- Ein enges Erhebungsfenster maximiert die Vergleichbarkeit, stellt jedoch praktische Herausforderungen dar und würde wahrscheinlich wiederholte Besuche zur Bewertung verschiedener Faktoren erfordern.
Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die Erhebung detaillierterer Bewirtschaftungsinformationen eine bessere Interpretation der Ergebnisse ermöglichen würde.
Dennoch beziehen sich die wichtigsten Schlussfolgerungen auf spezifische Themen und lauten wie folgt:
Was die Feldbewirtschaftung betrifft, so werden die meisten ökologischen Flächen seit 10–15 Jahren ökologisch bewirtschaftet. Der Umfang der für die Umstellung auf ein ökologisches System erforderlichen Änderungen variierte, aber die Fruchtfolge wurde auf allen Öko-Standorten geändert. Mit Ausnahme von zwei konventionell bewirtschafteten Feldern wurde auf allen Standorten organischer Dünger ausgebracht. Bei der konventionellen Bewirtschaftung wurde häufiger gepflügt, und Insektizide und Fungizide wurden auf der Hälfte bzw. allen konventionellen Flächen eingesetzt. Aus den Angaben der Vertragsinhaber zur Bewirtschaftung der Flächen geht hervor, dass auf allen kontrafaktischen Flächen im Vorjahr Fungizide und auf acht Flächen Insektizide eingesetzt worden waren.
Was die Bodeneigenschaften anbelangt, so gab es zwar nur wenige signifikante Unterschiede bei den chemischen Bodeneigenschaften zwischen den Bewirtschaftungssystemen, aber die organische Substanz (Glühverlust) und das extrahierbare Magnesium waren bei der ökologischen Bewirtschaftung von Fruchtfolgeflächen (OT3) signifikant höher als bei der konventionellen. Das Fehlen eines signifikanten Unterschieds beim Tongehalt deutet darauf hin, dass die Auswahl der Standortpaarungen auf der Grundlage des Bodentyps erfolgreich war. Es gab keine Unterschiede zwischen den Bewirtschaftungsebenen in Bezug auf die Schüttdichte des Bodens oder den strukturellen Zustand des Bodens (visuelle Bewertung oder Bodenausbreitungsverhältnis). Es gab einige Unterschiede zwischen den gepaarten Standorten bei der Anzahl der Regenwürmer für die verschiedenen Ökotypen (endogene und Midden-Zahlen als Surrogat für anekische Regenwürmer). Insgesamt gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen OT3 und konventionell bewirtschafteten Flächen. Die Vegetations-/Restbedeckung war bei OT3 höher als bei der konventionellen Bewirtschaftung und schien mit den Unterschieden im Anbau zusammenzuhängen.
Hinsichtlich des Wassererosionsrisikos war das Niveau des Erosionsrisikos bei OT3 und konventionellen Standorten sehr ähnlich, und auch das Ausmaß der Erosionsrisikominderung durch das Management war ähnlich. Die meisten Standorte wiesen eine geringe oder sehr geringe Landschaftsvernetzung auf, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass erodierter Boden in ein Gewässer gelangt, gering war. Allerdings waren die Werte für gute Bewirtschaftungsbedingungen in Bezug auf den Schutz von Wasserläufen bei Standorten, die nach OT3 bewirtschaftet wurden, höher als bei konventionellen Standorten.
In Bezug auf das Bodenbiom wurden signifikante Unterschiede zwischen ökologischen und konventionellen Gruppen bei der Alpha-Diversität der Bakterienpopulationen festgestellt, nicht jedoch bei den anderen getesteten Organismen. Bei einer Reihe von Bakterien- und Pilzarten wurde ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang mit den Praktiken der Ökologischen Landwirtschaft festgestellt. Die genetische Sequenzierung ergab keine Unterschiede in den Wurm-Populationen zwischen den beiden Anbaupraktiken.
Was die Landschaft betrifft, so konnte für zwei dieser Cluster nur eine einzige vergleichbare Gitterzelle in der 5x5-Nachbarschaft gefunden werden, so dass ein statistischer Vergleich nicht möglich war. In den übrigen neun Clustern zeigte nur ein Satz von Landschaftsmetriken für die Fokuszelle einen signifikanten Unterschied zu den Landschaftsmetriken für die umliegenden konventionellen Zellen. An diesem Standort war die durchschnittliche Parzellengröße größer und das Verhältnis von Fläche zu Umfang war höher, was auf eine geringere Komplexität der Landschaft hindeutet. Unabhängig von den Signifikanztests gab es in den Clustern kein einheitliches Muster in Bezug auf den Unterschied zwischen den Metriken der ökologischen Schwerpunktzellen und den Metriken der Nachbarschaften. Die neun untersuchten Cluster ökologischer Optionen wiesen sowohl höhere als auch niedrigere Metrikwerte für die Komplexität der Landschaft in den Fokuszellen auf als die durchschnittlichen Metrikwerte für die vergleichbaren konventionellen Zellen in der Nachbarschaft.
Author(s)
Natural England