Reduktion von Treibhausgasen in der Landwirtschaft zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes
Ziel der Studie ist es, spezifische Annahmen, Minderungsmaßnahmen und Rahmenbedingungen zu entwickeln und zu simulieren, die zu einer Reduktion von Treibhausgasen in der Landwirtschaft in Österreich führen.
- Austria
- 2014-2022
- Environmental impacts
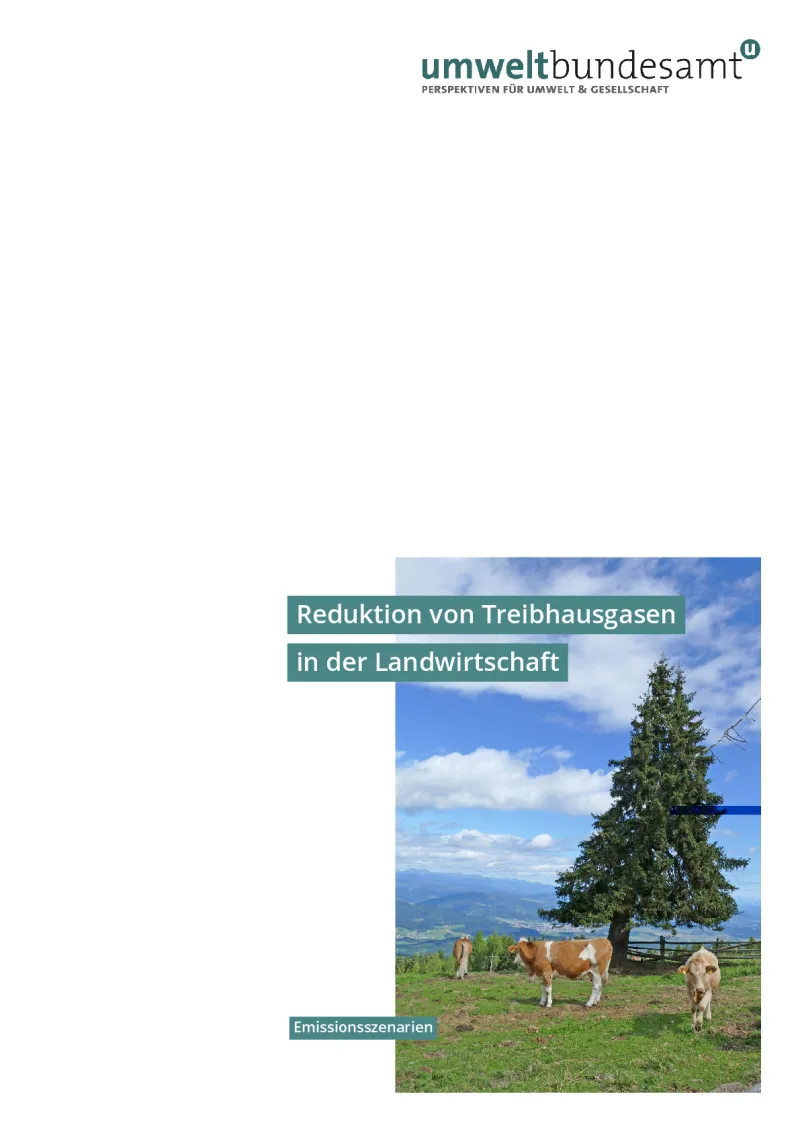

Dieser Bericht wird im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) und des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) erstellt und umfasst den Zeitraum 1990–2050.
Ziel dieser Studie ist es, spezifische Annahmen, Minderungsmaßnahmen und Rahmenbedingungen zu entwickeln und zu simulieren, die zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG) um 30 % (WAM+) und 40 % (WAM++) im Agrarsektor in Österreich führen.
Im Rahmen dieser Studie werden Szenarien der zukünftigen Aktivität und der THG-Emissionen und -Entnahmen aus der landwirtschaftlichen Flächennutzung entwickelt. Neben den Auswirkungen auf die THG-Emissionen werden auch die ökonomischen Effekte der Szenarien analysiert. Die Ergebnisse dienen als fachliche Grundlage für den politischen Entscheidungsprozess.
Hinsichtlich des methodischen Ansatzes beschreibt der Bericht die Veränderungen der THG-Emissionen aus dem IPCC-Sektor „Landwirtschaft“ und aus den Unterkategorien „Ackerland“ und „Grünland“ des IPCC-Sektors „Flächennutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“.
Die projizierten Aktivitätsdaten zu Viehbeständen, Milcherträgen, Stickstoffmengen von Mineraldünger und Ernteerträgen werden durch das Positive Agricultural Sector Model Austria (PASMA) geschätzt und dienen als Eingangsdaten für die Berechnung der Treibhausgasemissionen. Das makroökonomische Modell ADAGIO leitet die Auswirkungen auf Beschäftigung und Wertschöpfung für die gesamte Wirtschaft ab. Die Emissionen werden dann auf der Grundlage der für das österreichische Treibhausgasinventar verwendeten Methodik berechnet.
Basierend auf der Literaturanalyse beschreibt der Bericht das Potenzial der THG-Emissionsminderung der Maßnahmen des GAP-Strategieplans 2023–2027 und des EPLR 2014–2020.
Hinsichtlich der Einschränkungen wird festgestellt, dass die Einflüsse des Klimawandels in der PASMA-Analyse (über die Bewirtschaftung der Ernteerträge) berücksichtigt werden, jedoch nicht für die Schätzung der THG-Emissionen. Auch Flächennutzungsänderungen zu anderen Formen der Flächennutzung werden nicht berücksichtigt.
Was die wichtigsten Ergebnisse betrifft, so zeigt die Studie für den IPCC-Sektor „Landwirtschaft“, dass alle vier Szenarien eine Verringerung der THG-Emissionen für den Landwirtschaftssektor bis 2030, 2040 und 2050 aufweisen. Wie erwartet, sind die Reduzierungen im WEM-Szenario am geringsten und im WAM++-Szenario am größten. Die Haupttreiber der THG-Emissionen sind der Viehbestand, die Milcherträge und die N-Mengen an Mineraldünger.
In den Unterkategorien „Ackerland“ und „Grünland“ des IPCC-Sektors „Flächennutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“ ist der Hauptfaktor für die THG-Emissionen die Entwässerung und Bewirtschaftung von organischen Grünlandböden (etwa 13 000 ha laut dem aktuellen THG-Inventar). Die WEM- und WAM-Szenarien, bei denen keine Wiedervernässung organischer Böden durchgeführt wurde, zeigen einen leichten Anstieg der THG-Emissionen von Grünland bis 2050. Im Gegensatz dazu führt die Wiedervernässung bzw. Renaturierung von organischen Grünlandböden in den Szenarien WAM+ und WAM++ zu einer starken Reduktion der THG-Emissionen (2050: - 17 % in WAM+; - 47 % in WAM++ im Vergleich zu 2020). Insgesamt führen die angenommenen Maßnahmen in beiden Unterkategorien zu 2 % höheren THG-Emissionen im WEM-Szenario und zu 30 % niedrigeren THG-Emissionen im WAM++-Szenario im Jahr 2050.
Eine Reihe von Maßnahmen, sowohl im Agrarsektor als auch bei Acker- und Grünland, kann zu einer Verbesserung des THG-Inventars beitragen (z. B. Landschaftselemente, Grünlandböden, Einsatz stabilisierter Mineraldünger, Dungbehandlung).
Die Maßnahmen des GAP-Strategieplans 2023–2027 zielen einerseits auf die Speicherung von Kohlenstoff im Boden (Kohlenstoffsenken) und andererseits auf die Reduktion von THG-Emissionen – z. B. durch den Verzicht auf Mineraldünger oder durch eine klimafreundliche (und tiergerechte) Landwirtschaft. Aber auch der Einsatz von Erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz werden einbezogen. Der Beitrag der Maßnahmen zum Klimaschutz ist unterschiedlich und hängt stark vom Grad der Umsetzung ab (Anzahl der Landwirte, die die Maßnahmen umsetzen).
Was schließlich das EPLR 2014–2020 betrifft, so umfasst die Ausweitung der Produktion im Rahmen des EPLR landwirtschaftliche Tätigkeiten, die direkt mit THG-Emissionen verbunden sind (z. B. Viehhaltung und Mineraldüngereinsatz). Die Berechnungen der THG-Emissionen für den Landwirtschaftssektor ergaben daher einen Anstieg der THG-Emissionen um 2,6 % im Vergleich zur Situation ohne den Entwicklungsplan für den ländlichen Raum. Unter Berücksichtigung der THG-reduzierenden Effekte der Projekttypen Ökologische Landwirtschaft, Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel, Vermeidung von Fungiziden und bodennaher Gülleausbringung werden die mit der Produktionssteigerung verbundenen THG-Emissionen im Vergleich zur Situation ohne das EPLR von + 2,6 % auf + 0,7 % reduziert. Hinsichtlich der Emissionsminderung von Ammoniak haben die Modellberechnungen ergeben, dass das EPLR trotz höherer Viehbestände und größerer Mineraldüngermengen die Ammoniakemissionen um 2,6 % gegenüber der Situation ohne EPLR reduziert. Dies ist auf die emissionsmindernde Wirkung der Maßnahmen „bodennahe Ausbringung von Gülle und Biogasgülle“, „Tierwohlbefinden – Weide“, „Tierwohlbefinden – Stallaufstallung“ und „Investition in Güllelagerabdeckung“ zurückzuführen.
Author(s)
Michael Anderl, Manuela Bürgler, Simone Mayer, Erwin Moldaschl, Elisabeth Schwaiger, Bettina Schwarzl, Peter Weiss (Austrian Federal Environment Agency); Franz Sinabell (Austrian Institute of Economic Research – WIFO); Katharina Falkner, Martin Schönhart (University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU); Georg Dersch (Austrian Agency for Health and Food Safety – AGES)
Ressourcen
Documents
Reduction of greenhouse gases in agriculture to achieve the goals of the Climate Protection Act
(PDF – 3.31 MB – 221 pages)